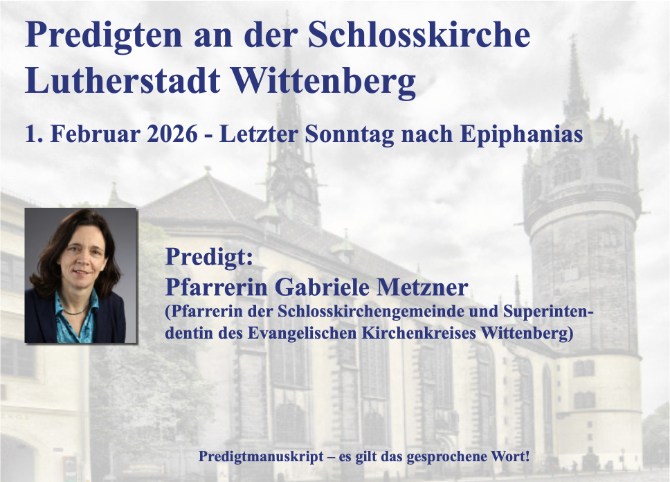
Heute wieder Johannes. Schon wieder, werden Sie denken. Hatten wir doch erst oder haben wir sogar das ganze Jahr über in der Jahreslosung aus dem vorletzten Kapitel der Offenbarung Johannes: Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. Neuschöpfung, neue Welt, hinter der alten versteckt, die manchmal so graue, so fehlerbehaftete und doch die einzige Welt, die wir kennen. Eine neue Welt, doch bis dahin, schaut nur. Schau nur, Johannes, was bis dahin geschieht.
Die Offenbarung des Johannes liest sich wie eine große Schau der Ereignisse bis zum Weltende. Mit filmreifen Bildern großer Ereignisse, die anstehen, bevor der neue Himmel kommt und das Neue sich bahnbricht.
So auch heute ganz am Anfang der Offenbarung. Vielleicht schließen Sie einfach die Augen und lassen die Bilder vor dem inneren Auge vorbeiziehen.
9 Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. 10 Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, 11 die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden: nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea. 12 Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter 13 und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. 14 Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme 15 und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen; 16 und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. 17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot; und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte 18 und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
Eine Freundin schickte mir in der vergangenen Woche Foto von ihrer Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer. Morgenlicht mit Kaffeetasse an der Reling, dunkle Wolken und stürmische See, weswegen sie den Kaffee nur innen genießen kann, tolle Ausblicke auf das Meer und in die Städte, die sie besucht. Schon als ich nach der Jahreslosung aus der Offenbarung Ausschau halte, suche ich nach dem Reiseziel Patmos, einer sehr kleinen Insel in der Ägäis. Dorthin müsste man mal reisen, denke ich. Dem Seher Johannes hinterher schauen, der dorthin verbannt wird oder, da sind die Forscher sich nicht ganz sicher, dorthin flieht. Da sitzt er nun so gut wie am Ende der Welt und schaut auf das Ende der Welt, das er mit den Christenverfolgungen unter Kaiser Domitian kommen sieht und sich Rat holt bei dem, der das A und das O ist, Alpha und Omega, Anfang und Ende.
Helles Licht, eine verlassene Insel, rauschendes Meer, das ist der Bildhintergrund, der in unserer Vorstellung etwas Anziehendes hat. Raus auf die Insel, Sonne und Meer, gerade jetzt, in der dunklen und kalten Zeit. Ein Traum.
Ein Mensch hört und sieht, was andere Menschen nicht sehen. Was er sieht, kann er nicht zuordnen, sondern beschreibt es in Bildern, die er kennt aus seiner Bibel. Eine Stimme wie eine Posaune und auch wie das Brausen des Meeres, ein Mensch mit goldenem Gürtel und goldenen Füßen, mit einem leuchtenden Antlitz und einem Schwert, das aus seinem Mund geht. Die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden, an die er schreibt und die sieben Sterne wie Engel, die über den Gemeinden wachen.
Was Johannes hier sieht, übersteigt seine Vorstellungskraft. Ein Mensch, aber erhabener als jeder Mensch. Ein Herrscher, aber erhabener als alle Herrscher, die er kennt. Ein Richter, aber mächtiger und rechtschaffener als alle, die über Menschen richten könnten.
Albrecht Dürer hat ihn gemalt, den Menschensohn der Offenbarung und in der Sakristei der Stadtkirche gleicht die Figur auf der Westseite dem Weltenrichter des Sehers Johannes, der auf Patmos die Heilige Schrift meditiert, besonders den Propheten Daniel im Alten Testament. Der die Ängste und die Scheußlichkeiten seiner Zeit vor Augen hat und Albrecht Dürer die finsteren Jahre am Ende des 15. Jahrhunderts. Die große Angst der Menschen vor dem Fegefeuer, Seuchen und Kriege, die ganze Völkerstämme ausrotten. Das finstere Gebaren der Despoten, die bestechlichen Richter, die Menschen töten und verfolgen.
Weil sie ihren Herrentag feiern, den ersten Tag der Woche, den Auferstehungstag, ein Skandal! Weil sie nicht nur in ihrer Familie Milde walten lassen, sondern auch gegenüber Fremden. Weil sie nicht den römischen Kaiser anbeten, sondern ihren Herrn der Welt.
„Fürchte dich nicht!“ Das ist das Vorzeichen vor allem, was noch kommt. Das taucht all die Schrecknisse und Ängste in ein neues Licht. Fürchte dich nicht! Das haben wir erst vor wenigen Wochen in der frohen Botschaft von Weihnachten gehört. Fürchte dich nicht! Dieser Ruf bleibt weiter nötig angesichts der Ereignisse, die kommen. Bei aller emotionalen Ergriffenheit, mit der sich die Offenbarungstexte lesen lassen, steckt darin doch eine große Nüchternheit. Was wir da sehen und wovon wir hören, was der Seher Johannes in seiner Schrift findet und was ihn und seinen Gemeinden das Fürchten lehrt, ist nichts Neues, wird in dieser unvollkommenen Welt nie etwas Neues sein. Und das ist zuallererst tröstlich. Schon Daniel war ergriffen von den Bildern und Ereignissen, durch die er Gottes Treue spürte und zum Protest aufrief gegen Mächte und Gewalten, die den Menschen das Leben nehmen.
Über die Jahrhunderte meditieren Menschen über den Worten und Bildern. Gefährlich werden sie denen, die Gewalt ausüben. Während der japanischen Besetzung Koreas im 2. Weltkrieg z.B. war es koreanischen Predigern verboten, Texte der Offenbarung zu lesen. Sie stacheln subversiv zu einem furchtlosen und aufrichtigen Bekenntnis an. Als Protestleute gegen den Tod hat einmal einer die Christen genannt.
Fürchte dich nicht! Mitten in dunkler Zeit leuchtet das Licht aus der Krippe in die Welt. Es ist dasselbe, das der Menschensohn ausstrahlt. Seine Herrschaftszeichen sind Gerechtigkeit und Wahrheit. Seine Vision von der neuen Zeit macht Mut, Spuren davon in der Gegenwart zu entdecken, so wie in Minnesota City, wo man einfach und als Gemeinschaft zu leben gelernt hat. Kirchen luden ein, Briefe an die somalischen Nachbarn zu schreiben, die gerade besonders verfolgt werden. Hunderte kamen. Sie sitzen beieinander, brechen gemeinsam das Brot und werden mit somalischen Gerichten beschenkt. Sie schreiben Karten mit herzlichen Botschaften. Ganze Schaufenster sind voll. Da steht zum Beispiel: Es kümmert uns, wie es euch geht. Ihr gehört zu uns.
„Fürchte dich nicht“ Das Licht von Weihnachten bringt Klarheit. Es hilft uns, nüchtern zu sein und beim Meditieren über Gottes Wort Rat und Antwort zu erhalten. Denn in diesem Licht stehen auch wir in Wittenberg oder auf Patmos, in Minnesota und in Sumy in der Ukraine und an all den Orten, die uns heute vor Augen sind.
Amen




